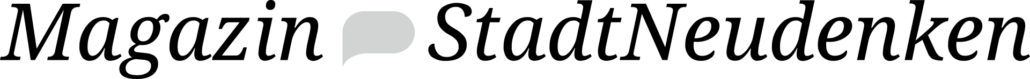Input von Matthias Grünzig
Nach einem kurzen Abriss der durchgeführten zwei Planungsphasen wird auf das Wettbewerbs- und Werkstattverfahren Molkenmarkt eingegangen. Dieses war ungeahnt erfolgreich, was u.a. auch mit den beiden ausgewählten Entwürfen zusammenhängt. Überraschend waren dann die Ereignisse auf dem Abschlusskolloquium im September, da die Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt verfügt hat, dass das Verfahren entgegen den Festlegungen der Auslobung ohne Auswahl eines Siegerentwurfes beendet wird. Das schadet der Wettbewerbskultur und nährt die Sorge, dass das bisherige Verfahren abgewickelt werden soll. Dies bestätigte sich mit dem Papier der SenSBW vom 26.09.2022 und der damit verbundenen Entwicklung des Masterplans durch SenSBW, der Erstellung eines Gestaltungshandbuchs und der Gründung eines Gestaltungsbeirats. Zu befürchten ist nun, dass ein Masterplan und eine Gestaltungssatzung erarbeitet werden, die schlussendlich zu hohen Bau- und Betriebskosten führen, bezahlbare Wohnungen sowie Raum für Kunst und Kultur ausschließt und schlussendlich eine Privatisierung notwendig macht, was insgesamt als Resultat zu teuren Wohnungen führt.
Daraus leiten sich folgende Forderungen ab:
- Abschluss des Wettbewerbs- und Werkstattverfahrens mit einem Siegerentwurf
- Fortsetzung des kooperativen Planungsprozesses
- Grundlagen für die weitere Planung bilden die acht Leitlinien, die Anforderungen aus der Auslobung des Wettbewerbs- und Werkstattverfahrens und der Siegerentwurf des Verfahrens
Manfred Kühne
SenSBW ist sehr froh, dass es die liegenschaftspolitische Wende gab und dass zweieinhalb Blöcke durch die WBM und die DeGeWo entwickelt werden. Mithilfe maximaler Partizipation und Kooperation sollte den vielen Zielkonflikten (maximale Anforderungen von allen Teilen der Verwaltung) entgegengetreten werden und ergründet werden, was möglich ist, unter Berücksichtigung der Leitlinien zur Bürgerbeteiligung. Nach der Nennung der beiden ersten Plätze des Wettbewerbsverfahrens geht es nun jedoch darum, die Lerneffekte des Werkstattverfahrens und die daraus extrahierten Empfehlungen zu nutzen sowie zu einzelnen wichtigen Punkten gemeinsame Gutachten zu erarbeiten.
Die Kritik vor Veröffentlichung des Protokolls des Werkstattverfahrens ist nicht verständlich und erschwert den Prozess. Der Auftrag an die städtischen Wohnungsbauunternehmen, günstigen Wohnraum zu bauen, hat weiterhin Bestand. Erprobte Erfolgsrezepte wie die Erstellung eines Gestaltungshandbuchs oder die Gründung eines fachlichen Beirats werden angewandt – diese haben sich in anderen Projekten bewährt. Unser Auftrag ist weiterhin, bald ins Bauen zu kommen und dann einen Mietpreis von 6,50 €/m² netto-kalt zu ermöglichen. Dies geht nur mit einer Städtebauförderkulisse und einem angemessenen Zuschusstitel für landeseigene Gesellschaften.
Enrico Schönberg
Das Vernetzungstreffen Rathausblock unterstützt die Aufrufe zum Molkenmarkt und hält eine Klärung für notwendig, ob ursprünglich getroffene Vereinbarungen zum Verfahren nicht eingehalten wurden. Frage ist jedoch darüber hinaus, inwiefern die Zivilgesellschaft sich im Sinne eines produktiven Missverständnisses in diesen Konflikt einbringen kann, indem etwa ein kooperatives Gremium für das Modellquartier gegründet wird. Dann könnte der Prozess der Ausarbeitung einer Gestaltungssatzung o.ä. gemeinsam diskutiert und in einer Kooperationsvereinbarung festgehalten werden. In der Gestaltung kann auch Leistbarkeit eine Leitlinie sein, wie am Rathausblock. Ob die Initiativen vor Ort ein Interesse an so einem Prozess haben, müssen diese entscheiden.
(Manfred Kühne interveniert dahingehend, dass es sich um keine Gestaltungssatzung, sondern ein informelles Instrument handeln soll.)
Katrin Schmidberger
Es ist sehr schade, dass sich Frau Kahlfeldt nicht der hiesigen Debatte stellt, da festgehalten werden muss, dass ein politischer Konsens aufgekündigt worden ist, wie solch ein Verfahren abgeschlossen wird. So ergibt sich der Verdacht, dass mindestens in Teilen der SenSBW, Eigeninteressen vor Gemeinwohlinteressen gestellt werden. Ebenso ist fraglich, warum es eines Gestaltungshandbuches bedarf, wo sich die WBM doch seit geraumer Zeit mit bezahlbarem Wohnen auseinandersetzt. Die Forderungen von Herrn Grünzig sind begründet und werden unterstützt. Es ist ein typisches Thema, wo es unterschiedliche politische Interessen und Auffassungen gibt und wo innerhalb der Koalition massiv gerungen wird. Der Molkenmarkt steht exemplarisch für die Notwendigkeit, sich immer wieder kämpferisch für einen langfristigen politischen Wandel einzusetzen. Vor dem Hintergrund von Privatisierungsforderungen seitens des Senats in Form von Andreas Geisel sind außerdem Bedenken hinsichtlich einer Privatisierung durchaus gerechtfertigt.
Steffen Helbig
Hinsichtlich von Privatisierungen lässt sich sagen, dass die WBM sich als langfristiger Bestandshalter versteht. Darüber hinaus wird auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Beiräten verwiesen, weswegen diesbezüglich keine Berührungsängste bestehen. Hohe Anforderungen hinsichtlich unterschiedlicher Aspekte führen schlussendlich zu einer Steigerung der Baukosten, sodass Finanzierungsbeiträge nicht gedeckt sind. Daher ist es notwendig, eine entsprechende Förderkulisse bereitzustellen. Ein Heißreden hinsichtlich der nah beieinander liegenden Gewinner:innenentwürfe ist nicht zielführend.
Matthias Grünzig
Bezüglich der Frage, für wen gesprochen wird, wird eine Anwaltschaft für den Prozess der Leitlinien Bürgerbeteiligung und deren Einbringung in den Planungsprozess genannt. Festgehalten werden muss, dass laut Auslobungsunterlagen ein einzelner Entwurf ausgewählt werden sollte, was nicht geschehen ist und den Aufwand der Planer:innen somit nicht würdigt. Das ist eine Katastrophe für die Wettbewerbskultur.
Der Vorschlag von Enrico Schönberg, einen kooperativen Planungsprozess zu etablieren, ist unterstützenswert. Große Sorge ist: Der Alleingang von Frau Kahlfeldt hat Vertrauen zerstört in ein Verfahren, das verschiedene Interessen ausgleicht. Es wurde dadurch eine Polarisierung erzeugt, die es so am Ende des Verfahrens eigentlich nicht mehr gab und jetzt das Projekt bedroht.
Johanna Sonnenburg
Johanna Sonnenburg tritt für einen Beitrag aus ihrer Rolle als Moderatorin zurück: In dem aktuell diskutierten Konflikt, geht es darüber hinaus auch über die Idee von der Mitte unserer Stadt, soll diese rekonstruiert werden oder soll es einen anderen Umgang damit geben. Die beiden Entwürfe repräsentieren hierbei die beiden Lager und da keine Entscheidung zu treffen, stellt ein Armutszeugnis dar, schwächt das Verfahren und verlangsamt den Prozess. In der Politik sieht man sich mit einem Scherbenhaufen konfrontiert.
Manfred Kühne
Es wurde kein einzelner Sieger:innenentwurf gewählt, da an solch einem Ort zwischen den Polen geplant werden muss. Die Zuspitzung „entweder Nostalgie oder Innovation“ wird dem Ort und dem Verfahren nicht gerecht. Von Anfang an war klar, dass nicht eines der beiden Gewinner:innenteams weiterplanen soll. Es soll darüber hinaus eine Charta ausgearbeitet werden, mit der erfasst wird, welche modellhaften Aspekte durch die WBM und die Degewo (und indealerweise die BImA und die K44) umgesetzt werden. In der Verantwortung sind nun die Bauherr:innen und damit verbunden auch die Klärung der Frage nach der Finanzierung.
Harry Sachs
Die Baukultur muss die Anforderungen des Klimawandels berücksichtigen. Im Rahmen der Baufelder der Initiative im Haus der Statistik wird angestrebt, deutlich über den üblichen Standard, auch unter Zugriff auf die Mitarbeit in Forschungsprojekten, hinauszugehen. Das Thema Freiraum ist weiterhin ein großes Thema, beispielsweise soll das Aktivitätenband prozesshaft mit Reallaboren befragt werden. Die Koop5 sind an diesem Thema dran und als Initiative wird durchaus eine höhere Geschwindigkeit gewünscht. Es braucht dafür öffentlichen Druck und politischen Willen, damit schlussendlich entsprechende Ressourcen und eine angemessene, langfristige Finanzierung zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus ist eine Raumvergabe vorgesehen, die durch diverse Akteur:innen aus der Zivilgesellschaft organisiert wird.
Florian Schmidt
Zum Thema Klima und Nachhaltigkeit: Im Rathausblock gibt es unterschiedliche AGs zu diesem Thema, welche offen sind und für die Stadtgesellschaft einen Bildungscharakter haben, wo gemeinsam gelernt wird. Weiterhin bleibt die Frage offen: Wie kann durch ganzheitliches Denken ein Neubauquartier hinsichtlich energetischer Konzepte, Energieerzeugung und Nutzung von Energie in Verbindung mit dem Bestand gebracht werden. Denkbar ist, dass Modellprojekte stärker in den umgebenden Stadtraum wirken könnten.
Sven Lemiss
Es bewegt sich in Richtung Nachhaltigkeit eine Menge, aber selbstredend ist noch wesentliches Potenzial vorhanden. Zirkuläres Bauen könnte beispielsweise in der Gesamtheit noch stärker mitgedacht werden. Weit vorne ist man hingegen im Thema Energieversorgung und Wärmepumpen. BIM, WBM und Stadtwerke haben hierzu einen gemeinsamen Vertrag unterzeichnet.
Harry Sachs
Diversität ist ein Prozess, dem wir uns im Team und in den Gremien stellen. Es gilt aus marginalisierten Gruppen Aktuer:innen zu machen, die im Rahmen des Prozesses mitentscheiden. Ganz selbstkritisch muss man sagen, dass es zwar durchaus Fortschritte gab, aber es muss weiterhin aktiv daran gearbeitet werden.
Sven Lemiss
Diversität fängt auch im eigenen Unternehmen an und auch bei der BIM gab es Fortschritte. Hinsichtlich des Themas Barrierefreiheit geht die BIM allerdings kampagnenartig voran. Bei der Frage nach der Einbindung von marginalisierten Gruppen steht die BIM jedoch sicherlich noch am Anfang.
Enrico Schönberg
Bei den ausgerufenen Zielen ist der Haushaltsgeber in der Pflicht, als Beispiel lässt sich der Gewerbehof im Rathausblock nennen, der wie ein Damoklesschwert wirkt. Dieser ist noch nicht finanziert, was sich kurzfristig ändern muss. Haushaltgeber muss nicht immer nur das Land sein, sondern ebenso der Bund. Es darf kein Zurückrudern geben in Bezug auf die mit einer Studie begründete hohe Quote an bezahlbarem Wohnraum.
Steffen Helbig
Seit Beginn des Jahres gibt es ein massiv gestiegenes Zinsniveau, ebenso sind die Bau- und Baunebenkosten in den letzten 8 Monaten um 27 % gestiegen. Um diese Kosten abzudecken, müsste die Miete um 2 €/m² steigen. Um dem entgegenzugehen, darf und kann nicht ausschließlich auf die öffentliche Hand geschaut werden, sondern auch andere Bausteine müssen auf den Prüfstand, ob das Einstiegsmieten oder Gewerbemieten sind, gleiches gilt für die Flächenvergabe. Welche Flächen sind für preisreduzierte Vermietung vorgesehen und welche für gemeinwohlorientierte Zwecke? Kann man diese Flächen reduzieren?
Sven Lemiss
Die Äußerungen von Enrico Schönberg sind zutreffend: Die Fassung von Beschlüssen ohne angemessene finanzielle Grundlage ist kein akzeptabler Zustand. Beim Thema Geschäftsmodell am Haus der Statistik ist die Vielzahl an Gesellschaften ein Problem, die Rechtskonstruktion hat durch ihre Komplexität den „Geschmack der Intransparenz“.
Andreas Foidl
Der Markt und die Preisbildung spielen eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung und daher sollte hinsichtlich dieser Aspekte die Modellhaftigkeit der Projekte überdacht werden. Bezahlbare Kredite sind ohne Sicherungsinstrumente (wie eine Grundschuld) nicht möglich und somit auch keine 6,5 €/m². Um eine ernsthafte Modellhaftigkeit zu gewährleisten, muss über Erbbaurecht oder Mietverträge mit Nießbrauch gesprochen werden. Inhaltliche, strategische Aspekte müssen im Fokus stehen und Fragen der Zuständigkeit geklärt werden, anstatt pauschal mit „geht nicht“ oder „nicht zuständig“ abzulehnen.
Enrico Schönberg
Eine Reduzierung der gemeinwohlorientierten Flächen kann keine Option sein und trimmt ein Modellprojekt auf die Normalität zurück. Im Koalitionsvertrag steht das genaue Gegenteil: Mehr Flächen sollen in eine soziale Nutzung gebracht werden. Es muss weniger Behelfslösungen geben und an einem Programm gearbeitet werden, welches dann auch umgesetzt wird. Es muss eine Entwicklung von Instrumenten bzw. Institutionen für das Land Berlin vorangetrieben werden, die generell auf Modellprojekte angewandt werden kann und nicht individuell an ein einzelnes Projekt angepasst ist.
Theresa Keilhacker
Der Molkenmarkt soll ein gemischtes Kultur- und Wohnquartier werden, in den acht Leitlinien ist eigentlich alles gesagt. Im Besonderen ist die fossilfreie Energieversorgung und Mobilität spannend. Die Charta „Intelligente Mobilität im Wohnquartier“ der Howoge ist hier richtungsweisend. Die Frage der Mobilität muss jetzt geklärt werden, anstatt nur über Fassaden zu reden.